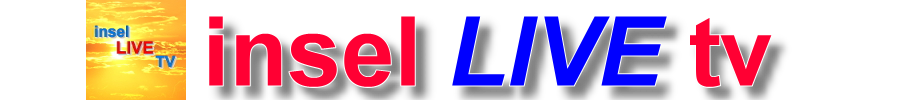Hund & Katz und mehr – Urteile deutscher Verwaltungs- und Zivilgerichte zum Thema Tierhaltung
Berlin (ots) – Viele Deutsche würden nur ungern auf die Haltung von Tieren in den eigenen vier Wänden verzichten. Diese Hausgenossen werden als Bereicherung des täglichen Lebens betrachtet.
Dabei sind die Interessen der Immobilienbesitzer höchst unterschiedlich: Die einen schätzen die altbewährten “Klassiker” wie Hunde und Katzen, die anderen finden Vergnügen daran, sich mit ausgefalleneren Hausgenossen wie Reptilien zu umgeben.
Grundsätzlich können zwei Probleme dabei auftauchen. Das eine ist die Frage, ob die Tierhaltung in bestimmten Wohnsituationen überhaupt erlaubt ist, weil sich Vermieter und Nachbarn gestört fühlen könnten. Die andere Frage stellt sich im Zusammenhang mit der artgerechten Haltung. Gelegentlich wird das von den Behörden überprüft und führt zu Auflagen oder Verboten. Die Extra-Ausgabe des Infodienstes Recht und Steuern der LBS stellt neun Urteile deutscher Gerichte zu diesem Thema vor.
Das generelle Verbot der Katzen- und Hundehaltung im Mietvertrag ist nicht rechtswirksam. Der Eigentümer einer 3‑Zimmer-Wohnung mit Balkon hatte seine Mieter aufgefordert, eine von ihnen gehaltene Katze zu entfernen, denn das sei ja vertraglich so vereinbart. Doch das Amtsgericht Köln (Aktenzeichen 210 C 103⁄12) bezeichnete das pauschale Verbot als rechtswidrig. Die grundsätzliche Bedeutung von Haustieren in unserer Gesellschaft erfordere es, eine Interessenabwägung durchzuführen. Diese habe hier nicht stattgefunden. Das Ergebnis hätte gelautet, dass solch ein verhältnismäßig kleines Tier auf 77 Quadratmetern durchaus leben könne.
Gerade Katzen werden häufig nicht nur innerhalb eines Hauses bzw. einer Wohnung gehalten, sondern erhalten “Freigang”. Ein Autobesitzer war der Überzeugung, dass die Nachbarskatze bei solch einem Ausflug die Karosserie seines Autos geschädigt habe und zog deswegen vor Gericht. Er behauptete, über Haare des besagten Tiers zu verfügen und einen DNA-Nachweis führen zu können. Das reichte dem Amtsgericht Aachen (Aktenzeichen 5 C 511⁄06) nicht aus, denn die Katze könne ja irgendwann tatsächlich ohne Folgen über das Autodach gelaufen sein. Man müsse das Tier schon ganz konkret beim Verursachen eines Schadens erwischt haben.
Eine Wasserschildkröte ist zwar kein besonders großes Tier, benötigt aber trotzdem ausreichend Platz, wenn sie innerhalb einer Wohnung gehalten werden soll. Ein Mann konnte der Schildkröte nur eine Wolldecke als Unterschlupf bieten und ließ sie ansonsten an einem öffentlichen Teich in der Nähe schwimmen, wobei er sie an einer Boje befestigte. Das alles schien dem zur Nachprüfung entsandten Amtsveterinär untragbar. Und das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen (Aktenzeichen 16 L 1319⁄11) vertrat nach einer Klage des Schildkrötenhalters die Auffassung des Amtes.
Manchmal übertreiben es Tierfreunde dramatisch, wenn man sie denn überhaupt noch so nennen kann. Die Mieterin einer gut 50 Quadratmeter großen Wohnung quartierte dort 80 Kanarienvögel und Zebrafinken, eine Katze und ein freilaufendes Kaninchen ein. Die Vögel hatten ein ganzes Zimmer als Voliere für sich. Das Amtsgericht Menden (Aktenzeichen 4 C 286⁄13) hielt eine fristlose Kündigung durch den Vermieter für angemessen, denn es liege eine klare Gefährdung der Mietsache vor.
Es kann grundsätzlich durchaus erlaubt sein, dass ein Immobilieneigentümer viele Tiere hält. Dann muss er diesen allerdings auch ein angemessenes Umfeld bieten. Ein Mann hatte sich für seinen entlegenen Aussiedlerhof elf deutsche Doggen angeschafft. Die Behörden verboten ihm das nicht von vorneherein. Sie wiesen ihn aber an, die Räume, die nicht ausschließlich Wohn-zwecken dienten, sondern in denen sich die Hunde aufhielten, aus hygienischen Gründen entweder zu fliesen oder mit einem abwaschbaren Anstrich zu versehen. Der Betroffene kam dem nicht nach, letzten Endes bestätigte deswegen das Verwaltungsgericht Koblenz (Aktenzeichen 2 K 30⁄16.KO) ein von den Behörden verhängtes Verbot jeglicher Tierhaltung.
Gelegentlich kommt es vor, dass ein Grundstückbesitzer ein verletztes Wildtier bei sich aufnimmt und es gesund pflegt. Im konkreten Fall handelte es sich um einen Habicht, der an einem Halsinfekt litt und ohne Hilfe kaum überlebensfähig gewesen wäre. Doch dem Bundesnaturschutzgesetz zu Folge musste der Greifvogel nach seiner Genesung unverzüglich freigelassen werden, entschied das Verwaltungsgericht Trier (Aktenzeichen 5 K 27⁄11.TR). Einziges Kriterium sei, dass er sich selbstständig erhalten könne.
Auch ein ständig im Freien gehaltener Hund hat einen Anspruch auf einen trockenen, geschützten Rückzugsort. Er darf aus Tierschutzgründen nicht dauerhaft bei jeder Witterung an einer Leine angebunden sein, denn das könne seiner Gesundheit erheblich schaden. Das Verwaltungsgericht Aachen (Aktenzeichen 6 L 23⁄13) bestätigte eine behördliche Anordnung, der zufolge eine Hundehütte bzw. ein witterungsgeschützter Liegeplatz errichtet werden müsste.
Bei giftigen Tieren erheben Behörden und Gerichte ganz besondere Anforderungen an den Halter. Ein Nachbar störte sich daran, dass ein anderer Hausbewohner 25 bis 30 Giftschlangen und sechs Pfeilgiftfrösche in seiner Wohnung untergebracht hatte. Der Nachbar fühlte sich durch den Geruch gestört und befürchtete auch die Möglichkeit des Entwischens der Tiere. Das Oberlandesgericht Karlsruhe (Aktenzeichen 14 Wx 51⁄03) entsprach der Klage, denn die Haltung von solch gefährlichen Schlangen und Fröschen überschreite den zulässigen Gebrauch des Sondereigentums durch einen Wohnungseigentümer.
Ein Schweinemastbetrieb in der Nachbarschaft hat nicht zwangsläufig eine unzumutbare Geruchsbelästigung zur Folge. Wenn ein neuer Stall über einen Abluftwäscher verfügt, der zu einer mindestens 70-prozentigen Geruchsminderung führt, dann müssen Anwohner in 550 bzw. 270 Metern Entfernung damit leben. So entschied es das Verwaltungsgericht Arnsberg (Aktenzeichen 7 K 2487⁄10). Unter Würdigung aller Umstände sei die Schweinemast im konkreten Fall noch zumutbar.
- Jülich – Vandalismus an Fahrradabstellanlage – 18. Juli 2024
- FC Bayern München spielt im Stadion Jülich – 17. Juli 2024
- Stoppschild missachtet – Radfahrerin schwer verletzt ! – 30. Mai 2024